Literarischer Exorzismus mit hohem Ekelfaktor
 David Peace: 1974
David Peace: 1974
David Peace schreibt sich die Seele aus dem Leib – so mein erster Eindruck nach der Lektüre seines Roman „1974″, der den Auftakt zum „Red Riding Quartett“, einer Chronik Englands in den 1970er und 1980er Jahren, bildet. Der Ekelfaktor bei diesem literarischen Exorzismus geht an die Grenze des Lesers: Wohl keine Körperflüssigkeit, die nicht in diesem Buch fließt. Es wird gerotzt, geblutet, gebrochen, gepißt, geschissen und abgespritzt. Dazu scheußliche Morde und Selbstmorde – „1974″ ist keine verkitschte Englandidylle sondern harter Stoff. Die Story, die während weniger Tage im Dezember 1974 im kalten Yorkshire spielt, klingt zunächst nach einer simplen Serienkillerstory: Edward Dunford will als neuer Gerichtsreporter bei der „Evening Post“ über das Verschwinden der kleinen Clare Kemplay berichten. Nicht nur sein verhaßter Reporterkollege und Rivale Jack Whitehead fährt ihm dabei in die Parade. Auch die Polizei macht Dunford mit ein paar Faustschlägen klar, dass er seine Nase nicht zu tief in schmutzige Angelegenheiten stecken soll.
Die Leiche der kleinen Clare wird kurze Zeit später gefunden, an ihr befestigt die abgeschnittenen Flügel eines Schwans. Trotz der Einschüchterungsversuche sucht Dunford weiter, findet einen möglichen Zusammenhang zwischen der ermordeten Clare und zwei weiteren, verschwundenen Mädchen, stößt dank seines Kollegen Barry auf eine dubiose Verbindung zum Bau neuer Häuser und Machenschaften der örtlichen Honoratioren. Nur kurze Zeit später ist auch Barry tot, angeblich ein Autounfall, geköpft durch eine Glasscheibe auf einem vor ihm fahrenden Transporter. Dunford steigert sich immer mehr in seine Story rein: Was als normaler, tragischer Fall eines verschwundenen und ermordeten Mädchen begann, wird für ihn zu einer Obsession. Am Ende wird es mehr Tote geben und Dunford bleibt mehrfach verprügelt, misshandelt und ausgebeutet ohne jegliche Hoffnung auf das, was Wahrheit genannt wird, zurück. Trostlosigkeit, wohin ich schaue.
Heftig, heftig, heftig
Bemerkenswert an Peaces Roman sind Tempo, Erzählperspektive und Figurenzeichnung. Der Autor beherrscht eine literarische Taktgeschwindigkeit, wie ich sie selten in Romanen gefunden habe. 145 Stundenkilometer war die Schusskraft des Fussballers Peter Lorimer, wie am Anfang des Buches erwähnt, und mit gleicher Geschwindigkeit hetzt Peace seinen Reporter Dunford durch die Geschichte. Knappe Sätze, heftige Dialoge, manchmal nur ein Schlagwort – und doch weiß man als Leser zu jeder Zeit, worum es gerade geht. Nur, dass es beim Fussball in der Regel ums Fair Play geht – das allerdings fehlt gänzlich bei Peace. Gerechtigkeit – vergiß es! Unvermittelt bekommt man den nächsten Brocken Schleim vor die Füsse gespuckt, plötzlich spritzt das Blut oder die Hirnmasse eines Selbstmörders klebt an der Wand. Nicht gerade lecker. Das man es trotzdem mit großer Aufmerksamkeit liest, liegt eben auch an dem Sog, an der Taktgeschwindigkeit, die Peace durch seine Prosa aufbaut. Es geht Peace auch nicht um billigen Splatter, sondern sein Roman ist eine Studie über die englische Gesellschaft, mit ihren Zeitungs- und Radioexzessen, mit ihrer dudelnden Pop- und Rockmusik und mit dem unterkühlten Umgang der Menschen untereinander.
Im Hinblick auf die Erzählperspektive hat Peace die wohl einzig mögliche Wahl getroffen: Er lässt die Geschichte von seinem Reporter Dunford aus der Ich-Perspektive erzählen. Auch hier geht er an Grenzen, denn wirklich sympathisch ist Zeilenschinder Dunford nicht. Er strapaziert mit seinem Zwiespalt aus Unterwürfigkeit und Aufmüpfigkeit, mit seinen Egotrips und Reporterexzessen die Geduld des Lesers. In manchen Momenten gönnt man ihm durchaus die Schläge in die Fresse, um sie gleich wieder zu bedauern, weil man weiß, dass er einer der Wenigen ist, die sich überhaupt an so etwas wie Gerechtigkeit wagen – wirklich gut ist er aber auch nicht. Generell sind die Peace’ Figuren zum größten Teil neutral bis unsympathisch und ungreifbar. Wirklich freundliche Menschen scheint es in der Hölle Yorkshires im Dezember 1974 nicht zu geben. Der Roman ist ein furchtbarer Alptraum, widerlich und saugut zugleich. In diesem Monat wählte die Jury der Krimiwelt den Roman auf Rang 1 ihrer Liste. Mit Recht, denn „1974″ ist englische Kriminalliteratur, wie sie auch sein kann: Brutal, ekelerregend, anstrengend und wichtig. Wie oben schon geschrieben,, ein literarischer Exorzismus mit dem Ziel, das Böse – wenn schon nicht aus- so doch aufzutreiben. Ich warte auf die Fortsetzung der Serie.
David Peace: 1974 / Aus dem Englischen von Peter Torberg. – München : Liebeskind, 2005
ISBN 3-935890-29-XOriginalausgabe: David Peace: Nineteen Seventy Four. – London : Serpent’s Tail, 1999
Weiterführende Links: → David Peace über sein „Red Riding Quartet“ in der Crime Time (engl.)
Buch bestellen bei:
» amazon.de » libri.de » buch24.de
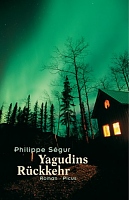 Philippe Ségur: Yagudins Rückkehr
Philippe Ségur: Yagudins Rückkehr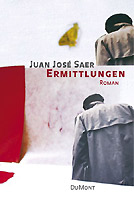 Juan José Saer: Ermittlungen
Juan José Saer: Ermittlungen
 Via
Via 
