 Möchte man als Leser eine Zeitreise zu den Anfängen der Kriminalliteratur unternehmen, möchte man Vorläufer und Vordenker des literarischen Verbrechens kennenlernen, dann richtet sich der Blick oft zunächst nach Großbritannien. Dabei lohnt es sich durchaus auch einen Blick auf die USA zu werfen. Leider wird dieser Blick etwas verstellt, denn bis auf die ganz großen Klassiker wie Edgar Allan Poe liegen die Werke anderer, ebenfalls wichtiger Autoren kaum in deutscher Übersetzung vor. Ein trauriges Beispiel ist Charles Brockden Brown, ein Urvater der amerikanischen Literatur überhaupt und Wegbereiter des psychologischen Kriminalromans. Von seinen vier Hauptwerken sind zur Zeit keine deutschen Übersetzungen lieferbar. Für September dieses Jahres ist immerhin ein günstiger Sammelband mit den Romanen „Wieland oder Die Verwandlung“ und „Arthur Mervyn oder die Pest in Philadelphia“ im → Area Verlag angekündigt.
Möchte man als Leser eine Zeitreise zu den Anfängen der Kriminalliteratur unternehmen, möchte man Vorläufer und Vordenker des literarischen Verbrechens kennenlernen, dann richtet sich der Blick oft zunächst nach Großbritannien. Dabei lohnt es sich durchaus auch einen Blick auf die USA zu werfen. Leider wird dieser Blick etwas verstellt, denn bis auf die ganz großen Klassiker wie Edgar Allan Poe liegen die Werke anderer, ebenfalls wichtiger Autoren kaum in deutscher Übersetzung vor. Ein trauriges Beispiel ist Charles Brockden Brown, ein Urvater der amerikanischen Literatur überhaupt und Wegbereiter des psychologischen Kriminalromans. Von seinen vier Hauptwerken sind zur Zeit keine deutschen Übersetzungen lieferbar. Für September dieses Jahres ist immerhin ein günstiger Sammelband mit den Romanen „Wieland oder Die Verwandlung“ und „Arthur Mervyn oder die Pest in Philadelphia“ im → Area Verlag angekündigt.
Wer Brown schon jetzt kennenlernen möchte, braucht nicht bis zum Herbst zu warten. Der kleine → Verlag Achilla Presse hat sich des Autors angenommen und das Fragment „Aus den Erinnerungen von Carwin dem Bauchredner“ erstmals in einer deutschen Übersetzung vorlegt. Diese literarische Ruine entstand im letzten Lebensjahrzehnt des Autors. Charles Brockden Brown, der am 17. Januar 1771 in Philadelphia geboren wurde, stammt aus einer strenggläubigen Quäker-Familie. Von seinen religiösen Eltern zu einer juristischen Ausbildung angehalten, wurde Brown Assistent eines Rechtsanwalts. Dennoch betätigte er sich immer wieder auch als Dichter. Brown gilt als der erste amerikanische Schriftsteller, der es schaffte, von seinen Büchern zu leben. Sein Leben, von zahlreichen Krankheiten überschattet, war auch geprägt von den Folgen des amerikanischen Bürgerkriegs. So engagierte er sich in verschiedenen Literatur- und Debattierclubs und äußerte sich zu aktuellen, politischen Fragen. Er schrieb Essays für Zeitschriften und wurde Mitglied des „Friendly Clubs“, dessen Zeitschrift er als Herausgeber betreute.
Die vier Hauptwerke
Daneben schrieb er sechs Romane, von denen vier als Hauptwerke angesehen werden:
- „Wieland, or the Transformation. An American Tale“ – 1798 (dt. „Wieland oder die Verwandlung. Eine amerikanische Erzählung, erstmals 1973)
- „Ormond, or the Secet Witness – 1799 (keine deutsche Übersetzung bekannt)
- „Edgar Huntly, or: Memories of a Sleep-Walker – 1799/1800 (Eine frühere Version hatte den Titel „Sky-Walk, or the Man Who Was Unknown to Himself. dt.: „Edgar Huntly oder Der Nachtwandler“, anonyme Übersetzung erstmals 1857)
- „Arthur Mervyn, or: Memoirs of the Year 1793 – 1799/1800 (dt.: „Arthur Marvyn oder die Pest in Philadelphia“, anonyme Übersetzung erstmals 1858)
Ein Hauptmotiv, das sich durch das recht abwechslungsreiche Werk von Brown zieht, ist der Schrecken, der jedoch nicht, wie in so manchen englischen Schauerromanen einen übersinnlichen Ursprung hat, sondern der empirisch und rational nachgewiesen werden kann. Todesfälle durch eine Epidemie, religiöser Wahn, der zur Selbstverbrennung führt oder die Verführung durch einen Bauchredner sind nur einige der Facetten. Dabei ist ganz entscheidend, dass Brown seinen Blick auf die Psyche seiner Figuren richtet. Der Schrecken kommt nicht aus Deutschland, sondern aus der Seele – so lautet die oft zitierte Aussage von Edgar Allen Poe, der sich dabei auch auf sein Vorbild Charles Brockden Brown bezieht. Auch Nathaniel Hawthorne und Herman Melville wurden von Brown beeinflusst. Er selbst, der die deutsche Sprache beherrschte, bekam wiederum Anregungen bei der Lektüre deutsche Autoren wie Goethe, Schiller oder Kotzebue.
Dunkle Färbungen und reale Begebenheiten
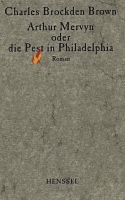 Auffällig weiterhin, das Brown ein Autor ist, der sich in seinen Texten auf reale Begebenheiten und Ereignisse bezieht – etwa die Fleckfieberepidemie im Jahre 1793 in Philadelphia – diese aber nicht als Kolportage in seine Romane einbaut, sondern sie als Metaphern und Bilder für seine Erzählung nutzt. Somit gilt Brown zu Recht als ein moderner Erzähler, der mit starken Symbolen arbeitete. Wenn überhaupt wird das Werk Browns hierzulande sehr verkürzt als Schreckens- oder Horrorliteratur wahrgenommen. Doch seine eleganten und eindringlichen psychologischen Zeichnungen, seine oft pessimistischen Figuren, die durchaus Noir-Färbungen aufweisen, sowie sein nüchterner Erzählstil können durchaus als Wegbereiter des modernen Kriminalromans gesehen werden. Charles Bockden Brown starb am 22. Februar 1810 an Tuberkulose.
Auffällig weiterhin, das Brown ein Autor ist, der sich in seinen Texten auf reale Begebenheiten und Ereignisse bezieht – etwa die Fleckfieberepidemie im Jahre 1793 in Philadelphia – diese aber nicht als Kolportage in seine Romane einbaut, sondern sie als Metaphern und Bilder für seine Erzählung nutzt. Somit gilt Brown zu Recht als ein moderner Erzähler, der mit starken Symbolen arbeitete. Wenn überhaupt wird das Werk Browns hierzulande sehr verkürzt als Schreckens- oder Horrorliteratur wahrgenommen. Doch seine eleganten und eindringlichen psychologischen Zeichnungen, seine oft pessimistischen Figuren, die durchaus Noir-Färbungen aufweisen, sowie sein nüchterner Erzählstil können durchaus als Wegbereiter des modernen Kriminalromans gesehen werden. Charles Bockden Brown starb am 22. Februar 1810 an Tuberkulose.
Ein frühes Vorbild für Kriminalerzählungen ist auch das Fragment „Aus den Erinnerungen von Carwin dem Bauchredner“ . Es ist die in Ich-Form erzählte Geschichte von Carwin, einem Bauernsohn, der das einfache Landleben seiner Eltern und seines Bruders satt hat. Als wissbegieriger junger Mann ist er froh, als seine Tante in Philadelphia in aufnimmt und er dem bäuerlichen Leben in Pennsylvania den Rücken kehren kann. Drei Jahre lebt er unbeschwert im Haus seiner Tante. Er entdeckt seine Fähigkeit, Stimmen zu imitieren und diese auch als Bauchredner einzusetzen. Eine Macht, mit der er andere beeinflussen und verwirren kann. Schließlich stirbt seine Tante. Fest hatte er mit der Erbschaft seiner Tante gerechnet, doch die Haushälterin soll laut Testament – dessen Rechtmäßigkeit er anzweifelt – alles erben. Mitten in den Überlegungen, wie er dennoch an das Geld seiner Tante kommen könnte, trifft Carwin auf den mysteriösen Ludloe. Dieser will ihn für eine Geheimgesellschaft anwerben und mit ihm fremde Inseln kolonisieren. Immer stärker gerät Carwin in die Abhängigkeit von Ludloe, der schließlich in das Innerste seines Zöglings schauen kann. Carwin ist zu einer Marionette Ludloes geworden. Dann bricht das Fragment ab.
Vom Täter zum Opfer
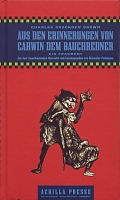 Die Figur des Bauchredners Carwin taucht bereits in Browns Roman „Wieland oder Die Verwandlung“ auf. Dort zerstört Carwin die Harmonie zwischen den Geschwistern Clara und Wieland sowie Claras Geliebten Pleyel. Carwins Einflüsterungen führen dazu, das Wieland in einem religiösen Wahn Clara tötet und sich schließlich selbst umbringt. In dem Fragment hingegen wird Carwin selbst zu einem Abhängigen und Getriebenen, seine Verwandlung von Täter zum Opfer zeichnet sich ab. Dies ist durchaus spannend zu lesen. Gerade Browns psychologische Beschreibungen heben die Erzählung hervor. Allein: Als Einstieg für das Werk von Charles Brockden Brown ist „Aus den Erinnerungen von Carwin dem Bauchredner“ nicht geeignet. So löblich es ist, dass dieses Fragment nun vorliegt, dringlicher ist eine Neuausgabe der vier Hauptwerke Browns in deutscher Sprache. In den USA ist zwischen 1977 und 1987 eine → sechsbändige, kritische Neuausgabe erschienen. Vielleicht schafft sie ja den Sprung über den Atlantik in einer guten Übersetzung. Charles Brockden Brown hätte es verdient.
Die Figur des Bauchredners Carwin taucht bereits in Browns Roman „Wieland oder Die Verwandlung“ auf. Dort zerstört Carwin die Harmonie zwischen den Geschwistern Clara und Wieland sowie Claras Geliebten Pleyel. Carwins Einflüsterungen führen dazu, das Wieland in einem religiösen Wahn Clara tötet und sich schließlich selbst umbringt. In dem Fragment hingegen wird Carwin selbst zu einem Abhängigen und Getriebenen, seine Verwandlung von Täter zum Opfer zeichnet sich ab. Dies ist durchaus spannend zu lesen. Gerade Browns psychologische Beschreibungen heben die Erzählung hervor. Allein: Als Einstieg für das Werk von Charles Brockden Brown ist „Aus den Erinnerungen von Carwin dem Bauchredner“ nicht geeignet. So löblich es ist, dass dieses Fragment nun vorliegt, dringlicher ist eine Neuausgabe der vier Hauptwerke Browns in deutscher Sprache. In den USA ist zwischen 1977 und 1987 eine → sechsbändige, kritische Neuausgabe erschienen. Vielleicht schafft sie ja den Sprung über den Atlantik in einer guten Übersetzung. Charles Brockden Brown hätte es verdient.
Charles Brockden Brown: Aus den Erinnerungen von Carwin dem Bauchredner : Ein Fragment / Aus dem Amerikanischen übersetzt und herausgegeben von Alexander Pechmann. – Stollhamm-Butjadingen : Achilla Presse, 2005
ISBN 3-928398-87-3
Amerikanischer Originaltitel: Memoirs of Carwin the biloquist. A Fragment.
Bestellungen über den → Verlag Achilla Presse oder in ausgesuchten Buchhandlungen.
Weiterführende Links:
→ Charles Brockden Brown Society (engl.)
→ Umfangreiche Linkliste (engl.)
→ Informationen zur amerikanischen Neuausgabe (engl.)
E-Texte als PDF-Dokumente bei BlackMask
→ Arthur Mervyn
→ Edgar Huntley
→ Memoirs of Carwin the Biloquist
→ Ormond
→ Wieland
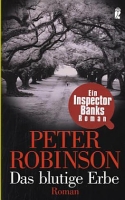 Peter Robinson: Das blutige Erbe
Peter Robinson: Das blutige Erbe Möchte man als Leser eine Zeitreise zu den Anfängen der Kriminalliteratur unternehmen, möchte man Vorläufer und Vordenker des literarischen Verbrechens kennenlernen, dann richtet sich der Blick oft zunächst nach Großbritannien. Dabei lohnt es sich durchaus auch einen Blick auf die USA zu werfen. Leider wird dieser Blick etwas verstellt, denn bis auf die ganz großen Klassiker wie Edgar Allan Poe liegen die Werke anderer, ebenfalls wichtiger Autoren kaum in deutscher Übersetzung vor. Ein trauriges Beispiel ist Charles Brockden Brown, ein Urvater der amerikanischen Literatur überhaupt und Wegbereiter des psychologischen Kriminalromans. Von seinen vier Hauptwerken sind zur Zeit keine deutschen Übersetzungen lieferbar. Für September dieses Jahres ist immerhin ein günstiger Sammelband mit den Romanen „Wieland oder Die Verwandlung“ und „Arthur Mervyn oder die Pest in Philadelphia“ im
Möchte man als Leser eine Zeitreise zu den Anfängen der Kriminalliteratur unternehmen, möchte man Vorläufer und Vordenker des literarischen Verbrechens kennenlernen, dann richtet sich der Blick oft zunächst nach Großbritannien. Dabei lohnt es sich durchaus auch einen Blick auf die USA zu werfen. Leider wird dieser Blick etwas verstellt, denn bis auf die ganz großen Klassiker wie Edgar Allan Poe liegen die Werke anderer, ebenfalls wichtiger Autoren kaum in deutscher Übersetzung vor. Ein trauriges Beispiel ist Charles Brockden Brown, ein Urvater der amerikanischen Literatur überhaupt und Wegbereiter des psychologischen Kriminalromans. Von seinen vier Hauptwerken sind zur Zeit keine deutschen Übersetzungen lieferbar. Für September dieses Jahres ist immerhin ein günstiger Sammelband mit den Romanen „Wieland oder Die Verwandlung“ und „Arthur Mervyn oder die Pest in Philadelphia“ im 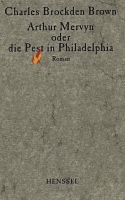 Auffällig weiterhin, das Brown ein Autor ist, der sich in seinen Texten auf reale Begebenheiten und Ereignisse bezieht – etwa die Fleckfieberepidemie im Jahre 1793 in Philadelphia – diese aber nicht als Kolportage in seine Romane einbaut, sondern sie als Metaphern und Bilder für seine Erzählung nutzt. Somit gilt Brown zu Recht als ein moderner Erzähler, der mit starken Symbolen arbeitete. Wenn überhaupt wird das Werk Browns hierzulande sehr verkürzt als Schreckens- oder Horrorliteratur wahrgenommen. Doch seine eleganten und eindringlichen psychologischen Zeichnungen, seine oft pessimistischen Figuren, die durchaus Noir-Färbungen aufweisen, sowie sein nüchterner Erzählstil können durchaus als Wegbereiter des modernen Kriminalromans gesehen werden. Charles Bockden Brown starb am 22. Februar 1810 an Tuberkulose.
Auffällig weiterhin, das Brown ein Autor ist, der sich in seinen Texten auf reale Begebenheiten und Ereignisse bezieht – etwa die Fleckfieberepidemie im Jahre 1793 in Philadelphia – diese aber nicht als Kolportage in seine Romane einbaut, sondern sie als Metaphern und Bilder für seine Erzählung nutzt. Somit gilt Brown zu Recht als ein moderner Erzähler, der mit starken Symbolen arbeitete. Wenn überhaupt wird das Werk Browns hierzulande sehr verkürzt als Schreckens- oder Horrorliteratur wahrgenommen. Doch seine eleganten und eindringlichen psychologischen Zeichnungen, seine oft pessimistischen Figuren, die durchaus Noir-Färbungen aufweisen, sowie sein nüchterner Erzählstil können durchaus als Wegbereiter des modernen Kriminalromans gesehen werden. Charles Bockden Brown starb am 22. Februar 1810 an Tuberkulose. 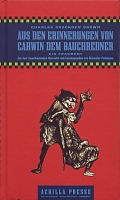 Die Figur des Bauchredners Carwin taucht bereits in Browns Roman „Wieland oder Die Verwandlung“ auf. Dort zerstört Carwin die Harmonie zwischen den Geschwistern Clara und Wieland sowie Claras Geliebten Pleyel. Carwins Einflüsterungen führen dazu, das Wieland in einem religiösen Wahn Clara tötet und sich schließlich selbst umbringt. In dem Fragment hingegen wird Carwin selbst zu einem Abhängigen und Getriebenen, seine Verwandlung von Täter zum Opfer zeichnet sich ab. Dies ist durchaus spannend zu lesen. Gerade Browns psychologische Beschreibungen heben die Erzählung hervor. Allein: Als Einstieg für das Werk von Charles Brockden Brown ist „Aus den Erinnerungen von Carwin dem Bauchredner“ nicht geeignet. So löblich es ist, dass dieses Fragment nun vorliegt, dringlicher ist eine Neuausgabe der vier Hauptwerke Browns in deutscher Sprache. In den USA ist zwischen 1977 und 1987 eine
Die Figur des Bauchredners Carwin taucht bereits in Browns Roman „Wieland oder Die Verwandlung“ auf. Dort zerstört Carwin die Harmonie zwischen den Geschwistern Clara und Wieland sowie Claras Geliebten Pleyel. Carwins Einflüsterungen führen dazu, das Wieland in einem religiösen Wahn Clara tötet und sich schließlich selbst umbringt. In dem Fragment hingegen wird Carwin selbst zu einem Abhängigen und Getriebenen, seine Verwandlung von Täter zum Opfer zeichnet sich ab. Dies ist durchaus spannend zu lesen. Gerade Browns psychologische Beschreibungen heben die Erzählung hervor. Allein: Als Einstieg für das Werk von Charles Brockden Brown ist „Aus den Erinnerungen von Carwin dem Bauchredner“ nicht geeignet. So löblich es ist, dass dieses Fragment nun vorliegt, dringlicher ist eine Neuausgabe der vier Hauptwerke Browns in deutscher Sprache. In den USA ist zwischen 1977 und 1987 eine 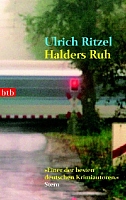 Ulrich Ritzel: Halders Ruh
Ulrich Ritzel: Halders Ruh
