Der Kommentar von Silvia Kaffke – ein wahrlich trauriges Beispiel von Geschichtswahrnehmung – kann man bei Toms Krimitreff nachlesen. Meine Erwiderung folgt hier – oder wahlweise dort.
Hallo Silvia,
immerhin, nach fast eineinhalb Monaten eine Reaktion von einer der beteiligten Autorinnen. Nun, wenn ich mich so gewaltig irre – warum wurde mein „Irrtum“ nicht schon früher aufgeklärt? Warum gab es keine Reaktion, weder vom Verlag noch von den beteiligten Autor/innen?
Da wählt Ihr bewusst einen Titel, der zweideutig ist. Einerseits der Begriff „Terminus“, der laut Silvia „wohl den wenigsten geläufig ist“, als Begriff für „Endbahnhof“, „Endgültigkeit“. Wenn die Leser doch so dumm sind, warum klärt Ihr sie darüber dann nicht auf?
Andererseits der Namen „Hotel Terminus“, der historisch belastet ist – ob einem das nun gefällt oder nicht. Natürlich, das Hotel im Roman von „12 preisgekrönten Krimi-Autoren“ hat nichts mit der Folterkammer des Klaus Barbie in Lyon zu tun. Die kennt nämlich heute kaum noch einer. Woran liegt das? Weil der Film von Marcel Ophüls nun auch schon seit ein paar Jahren im Archiv einstaubt? Weil wir Deutschen angeblich ständig mit unserem „Mea Culpa“ beschäftigt sind? Wohl kaum, dann würde dieser Hotelname vielleicht auch bis in die Chefetagen der deutschen und ausländischen Hotels vorgedrungen sein und dort würde man sich vielleicht überlegen, ob man ein Hotel – aufgrund der Begriffsdefinition und als historisch belasteter Name – wirklich so nennen würden. Aber es geht hier nicht um Kritik an Hotels – es geht mir, wer hätte es gedacht, um Kriminalliteratur.
„Wenn es Leute Leute gibt, die sich an Klaus Barbies Untaten erinnert fühlen – gut, das soll nicht vergessen werden. Aber wieder mit unserem typischen deutschen Mea Culpa, ein Buch, das so heißt, nichts mit Lyon zu tun hat und möglicherweise unterhält und deshalb gaaaanz gaaanz böse ist, nicht zu lesen, ist doch einfach hirnrissig.“ schreibt Silvia.
Eine, milde formuliert, eigenwillige und in meinen Augen flache historische Wahrnehmung. Mir kommen schon die ersten Sätze Eures Romans widerlich vor. Ein Bezug zum Schlachthof von Barbie wird zwar nicht hergestellt, dennoch wird dieser Name benutzt. Wozu? Nur weil „Endstation“ so passend sein soll? Dann kann man das Ding auch „Hotel Endstation“ nennen. Die Leser/innen, denen der Begriff „Terminus“ ja so wenig geläufig ist, würden dass dann auch vielleicht eher verstehen – und was Ihr damit gemeint habt.
Wie mögen aber die zitierten Anfangsworte Eurer platten Krimigeschichte in den Ohren der Opfer bzw. ihrer Nachfahren klingen? Wie mögen sich die Menschen gefühlt haben, die in dieser Endstation jeglicher Menschlichkeit zu Tode gekommen sind? Wie lustig mag das sein? Welche Gewichtung legt Ihr zwischen einem harmlosen Krimi, der in einer abgewrackten Kaschemme in irgendeiner deutschen Großstadt spielt, und den Qualen der Menschen, die Barbie zur Folter- und Schlachtbank führte? Und was, liebe Silvia, ist daran verkehrt, daran zu erinnern und ein Bewusstsein dafür zu entwickeln?
Richard von Weizsäcker hat in seiner viel beachteten Rede am 8. Mai 1985 gesagt:
„Bei uns ist eine neue Generation in die politische Verantwortung hereingewachsen. Die Jungen sind nicht verantwortlich für das, was damals geschah. Aber sie sind verantwortlich für das, was in der Geschichte daraus wird.“
Angesichts zunehmender, rechtsextremer Tendenzen, einer ständigen Verdrängung dessen, was während des Nationalsozialismus geschah, eines wachsenden Widerstandes gegen die Erinnerung, eine Forderung, die in meinen Augen notwendiger und aktueller denn je ist. Ich nehme sie ernst. Offenbar auch einige Deiner Kollegen, denn erst vor einigen Monaten hat Horst Eckert (er gehört auch zu den Autoren des „Hotel Terminus“-Romans) in seiner Rede „Krimis in Deutschland: Tendenzen“ Folgendes gesagt:
„Wo ich in Deutschland noch Nachholbedarf sehe, ist vor allem die Aufarbeitung der jüngeren Geschichte, nämlich der Nazizeit und der DDR-Diktatur. Da liegt ein literarischer Quell besonderer Dramatik noch weitgehend brach – vielleicht, weil bislang der nötige Abstand und die Unbefangenheit fehlte, um aus solchen Stoffen Spannungsliteratur zu machen.“
Ich mag dem Mann gerne Recht geben, nur frage ich mich, wie weit diese Unbefangenheit gehen darf? Abgesehen davon, ob man eine solche Beschäftigung im Genre Krimi so fordern kann, aber das ist eine andere Frage. In meinen Augen darf die Unbefangenheit zumindest nicht soweit gehen, wie Ihr mit der Namenswahl für das Hotel in Eurem Roman gegangen seid, weil die Relationen – hier die Qualen der Barbie-Opfer, dort typisch klischeehafte Randexistenzen, die in jedem zweiten deutschen Krimi auftauchen – einfach nicht stimmen. Wie schon gesagt, niemand würde einen harmlosen Krimi in einem fiktiven Hotel Auschwitz spielen lassen – das ist schlicht geschmacklos.
Noch entsetzlicher wird dies alles, wenn man zum Beispiel den Anfang des letzten Kapitel von Jürgen Alberts liest, wo er sich in plumpen und beliebten Antiamerikanismus ergeht – vor dem Hintergrund der historischen Tatsachen (wer hat uns vom Nationalsozialismus befreit?, Na, wer wars? – Richtig: Die Amis, die Russen, die Franzosen und die Engländer) zusammen mit dieser geschmacklosen Namenswahl ist dies in meinen Augen einfach nur dumm und dämlich! Ich habe auch meine Probleme mit Herrn Bush und seiner Sicht der Welt, aber so einfach, wie es im Roman geschildert wird, ist es nicht. Dumpfbackiges „Gegen-Amerika“ mag sich in Zeiten wie diesen gut verkaufen.
Entlarvend geradezu Deine Bemerkung, dass „wir hoffen“ (jawohl, Eure Majestät) das Buch halte sich nun in der Diskussion – obwohl es gar nicht beabsichtigt war. Einerseits habt Ihr angeblich darüber diskutiert, andererseits nicht gehofft, es komme zu einer Diskussion außerhalb Eures erlauchten Autor/innenkreises dazu? Bitte, was hast Du – ‚tschuldigung Ihr – für ein Verständnis und für eine Wahrnehmnung von Euren Leser/innen? Ihr diskutiert darüber, hofft aber, dass dies die Leser nicht tun? Merkwürdig.
Zum Schluss noch eine Bemerkung zum Thema „bashen“: In Zukunft würde ich es vorziehen, wenn Du von Kritik sprichst. „To bash“ kann zwar als heftige Kritik verstanden werden, aber das Wort hat – zweideutig, zweideutig – auch die Bedeutung, dass man jemanden schlägt oder verprügelt. Da Ihr ja offenbar Schwierigkeiten mit Zweideutigkeiten habt, möchte ich nur klarstellen: Als friedliebender Mensch schlage ich niemanden und ich schlage auch keine Bücher, noch halte ich jemanden davon ab, Euren Quatsch zu lesen. Ich sage lediglich, was ich darüber denke – weil ich Kriminalliteratur nicht als Einbahnstraße verstehe.
Liebe Grüße
Ludger
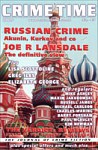 Russian Crime ist das Schwerpunktthema in der 43. Ausgabe der
Russian Crime ist das Schwerpunktthema in der 43. Ausgabe der 