Zeit

„Er fragte wahrhaftig gar nichts danach, was »die Leute« (er meinte die Herren Lehrer) wußten und lächerlicherweise ihm mitzuteilen wünschten. Er war ganz gut so, wie er war, und – kurz und gut, es war eine Niederträchtigkeit, im Sommer um sieben und im Winter um acht »da sein« zu müssen, um sich doch nur mit völliger Verachtung strafen zu lassen; da »alles andere doch nichts half«.“
Wilhelm Raabe: Stopfkuchen
Glücklicherweise geht es in der beliebten Crime-School entspannter, wenn auch nicht weniger arbeitsintensiv zu. Nun steht also ein Repetitorium an. In der letzten Schulstunde behandelte Lehrer dpr das Thema Zeit, genauer gesagt die „Lese-Zeit-Richtung“ und suchte Beispiele für originelle Beispiele, wie in Kriminalromanen mit Zeit gearbeitet wird. Mir fiel dazu zwar kein Krimi ein, dafür erinnerte ich mich an einen Roman, der ähnlich wie ein Hüpfkastenspiel funktioniert. Die Rede ist von „Rayuela – Himmel und Hölle“ des Autors Julio Cortázar, Sohn argentinischer Eltern und in Brüssel geboren. In diesem Roman hat der Leser die Möglichkeit zur Interaktion – lange, bevor überhaupt jemand an Hypertext und Internet dachte. In kurzen Kapiteln erzählt Cortázar die Geschichte des Intellektuellen und Exilargentiniers Horacio Oliveira in seinem Pariser Exil und seine Rückkehr nach Buenos Aires. In „Das Buch der 1000 Bücher“ wird der 1963 erschienene Roman so beschrieben:
„Der Titel Rayuela (spanisch für das Hüpfkastenspiel Himmel-und-Hölle) ist für den Roman in doppelter Hinsicht bedeutsam. Formal, weil er sich unmittelbar auf die Lektüre bezieht, die nicht linear fortschreitet, sondern vom Leser ein Vor- und Zurückspringen innerhalb der drei Teile verlangt. Der erste Teil schildert Oliveiras Leben in Paris, der zweite zeigt ihn nach der Rückkehr in seine Heimat; der dritte Teil enthält »entbehrliche« Kapitel, die beim Lesen der ersten beiden Teile zwischengeschaltet werden können.
Auf inhaltlicher Ebene kommt dem »Rayuela«-Spiel leitmotivische Funktion zu: Oliveira begegnet dem Kreidestrichgebilde mehrmals bei seinen ziellosen Gängen durch die Straßen von Paris und beginnt es als Symbol zu interpretieren: Himmel und Hölle der menschlichen Existenz sollen wie die Kästchen des Spiels auf einer Horizontalen liegen und so dem Individuum mühelos zugänglich werden. „
Ein chronologisches Lesen ist also nicht sinnvoll, sondern der Leser „hüpft“ im Roman hin und her und blättert dementsprechend auch immer wieder vor und zurück.
In der Tat entwickelt sich die Crime-School zu einem wirklichen Lesemarathon – immer wieder neue Ideen und Anregungen für Bücher, die ich noch nicht gelesen habe oder die dringend wiedergelesen werden sollten. Wenn da das Zeit-Problem nicht wäre….
 Anregungen kommen dabei auch indirekt. Lehrer dpr hat mich an Arno Schmidt erinnert und in diesem Zusammenhang fiel mir ein weiterer Roman ein, den ich gerne endlich lesen möchte. „Was wird er damit machen? Nachrichten aus dem Leben eines Lords“ von Edward Bulwer-Lytton in einer Übersetzung vom Meister aus Bargfeld. Bulwer-Lytton ist bei uns vor allem durch seinen Roman „Die letzten Tage von Pompeji“ bekannt geworden – dabei dürfte die Entdeckung von „What will he do with it?“ – gerade auch unter Krimiaspekten – wesentlich spannender sein. Glücklicherweise ist die schöne, dreibändige Taschenbuchausgabe in einer Kassette wohl auch noch lieferbar – keine Selbstverständlichkeit in diesen Tagen. Wer das Buch nicht kaufen möchte, kann auch die englische Ausgabe aus dem Internet herunterladen und lesen. Ganz davon abgesehen, das mir in Bezug auf Arno Schmidt auch wieder Wilkie Collins einfällt und mich an eine dringende, wiederholte Lektüre von „Die Frau in Weiß“ mahnt, natürlich nur in der Übersetzung von Arno Schmidt.
Anregungen kommen dabei auch indirekt. Lehrer dpr hat mich an Arno Schmidt erinnert und in diesem Zusammenhang fiel mir ein weiterer Roman ein, den ich gerne endlich lesen möchte. „Was wird er damit machen? Nachrichten aus dem Leben eines Lords“ von Edward Bulwer-Lytton in einer Übersetzung vom Meister aus Bargfeld. Bulwer-Lytton ist bei uns vor allem durch seinen Roman „Die letzten Tage von Pompeji“ bekannt geworden – dabei dürfte die Entdeckung von „What will he do with it?“ – gerade auch unter Krimiaspekten – wesentlich spannender sein. Glücklicherweise ist die schöne, dreibändige Taschenbuchausgabe in einer Kassette wohl auch noch lieferbar – keine Selbstverständlichkeit in diesen Tagen. Wer das Buch nicht kaufen möchte, kann auch die englische Ausgabe aus dem Internet herunterladen und lesen. Ganz davon abgesehen, das mir in Bezug auf Arno Schmidt auch wieder Wilkie Collins einfällt und mich an eine dringende, wiederholte Lektüre von „Die Frau in Weiß“ mahnt, natürlich nur in der Übersetzung von Arno Schmidt.
 Hat der deutsche Krimi endlich eine Affäre? Wird er die Schlagzeilen auf den ersten Seiten beherrschen oder gar Einfluss auf den Wahlausgang im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW am 22. Mai 2005 nehmen? Sorgt sich
Hat der deutsche Krimi endlich eine Affäre? Wird er die Schlagzeilen auf den ersten Seiten beherrschen oder gar Einfluss auf den Wahlausgang im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW am 22. Mai 2005 nehmen? Sorgt sich  Autor Horst Eckert bezeichnet die Vorwürfe auf seiner
Autor Horst Eckert bezeichnet die Vorwürfe auf seiner 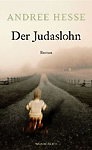 Andree Hesse: Der Judaslohn
Andree Hesse: Der Judaslohn In der aktuellen Lektion der
In der aktuellen Lektion der 