Kein Glück
Die Hamburger Lesetage und ich – wir kommen nicht zusammen. Wie schon im letzten Jahr werde ich Ende April nicht in der Hansestadt sein. Kriminell gibt es die ein oder andere interessante Veranstaltung, schade also.
Die Hamburger Lesetage und ich – wir kommen nicht zusammen. Wie schon im letzten Jahr werde ich Ende April nicht in der Hansestadt sein. Kriminell gibt es die ein oder andere interessante Veranstaltung, schade also.
Ein kleiner Ansatz zur der Hausaufgabe in der Crime-School. Was habe ich in den Tiefen des Archivs entdeckt? Zum Beispiel einen Artikel zur Geschichte des Detektivromans
Was eigentlich ein Detektivroman ist, hat viele Autoren und Literaturkritiker beschäftigt. Einige Autoren haben sich „Spielregeln“ für den Detetivroman ausgedacht. So etwa Ronald Knox, der 1924 in seinem „Detective Story Decalogue“ zehn Regeln aufstellte, oder S.S. Van Dine (Pseudonym für W.H. Wright), der 1928 in seinen „Twenty Rules for Writing Detective Stories“ zwanzig Regeln für das Verfassen von Detektivgeschichten aufstellte. Das Problem der „Regeln“,die sich besonders im „Goldenen Zeitalter“ verbreitet haben, ist nur, dass sich Schriftsteller selten an Regeln halten wollen und Schreiben „ein Beruf ist, in dem es keine Regeln gibt“ wie Agatha Christie bemerkte.
→ Der Detektivroman hat außerdem im Laufe der Zeit eine Entwicklung erfahren, die es gar nicht erlaubt, von einer bestimmten Definition des Detektivromans zu sprechen.
So grenzt etwa Richard Alewyn in seinem Aufsatz „Anatomie des Detektivromans“ den Detektivroman vom Kriminalroman ab. Für Alewyn ist der Detektivroman eine Geschichte, die gegen die Zeit erzählt wird, das heißt am Anfang steht die Entdeckung der bereits geschehen Tat (der Mord), ein Mordopfer wird gefunden, die ungeklärten Umstände der Tat werden im Laufe der Erzählung geschildert, das Tatmotiv wird gesucht und gefunden, schließlich wird am Ende das Verbrechen aufgeklärt.
Beim Kriminalroman hingegen wird, nach der Auffassung von Richard Alewyn, parallel zur Handlung erzählt: Die Figuren werden eingeführt, es gibt zwischen ihnen Motive und Beweggründe (Eifersucht, Neid, Haß etc.), die zu einer Mordtat führen. Obwohl ich diese strenge Abgrenzung von Detektiv- und Kriminalroman durch Alewyn nicht teilen kann (ich persönlich würde den Detektivroman als eine Unterart des Kriminalromans sehen, die neben anderen Arten wie zum Beispiel dem Thriller, Hard-boiled-Krimi etc. steht, die sich zum Teil aus dem Detektivroman abgespaltet haben), zeigt er doch wichtige Elemente eines Detektivromans auf. Um weitere Erzählelemente heraus zu arbeiten ist es sinnvoll, einmal auf die Geschichte und die Entwicklung des Genre zu schauen.
„The Murders in the Rue Morgue“ (dt. „Die Morde in der Rue Morgue“, erstmals erschienen 1841) von Edgar Allan Poe (1809-1849) wird in der Literatur oft als die erste „richtige“ Detektivgeschichte gesehen. Natürlich weisen einige frühere Romane, Erzählungen und Berichte einzelne Merkmale einer Detektivgeschichte auf, nämlich die Darstellung eines Mordes oder eines Verbrechens, ein Detektiv oder Polizist, der diesen Fall untersucht und schließlich den Täter überführen kann, aber in Poes Erzählung sind diese und andere wichtige Elemente erstmals zusammengefaßt.
So gibt es natürlich schon in der Bibel Mord und Totschlag (Kain und Abel), in den Erzählungen aus „Tausendundeiner Nacht“ finden sich Verbrechen und erwähnt wird immer wieder die Sammlung von Gerichtsfällen von Francois Gayot de Pitaval – kurz „Pitaval“ genannt, den man als Vorläufer unsere heutigen „True-Crime-Stories“ sehen könnte.
Aber Poes Geschichte enthält die wichtigsten Zutaten, die eine Detektivgeschichte ausmachen. Was aber sind nun diese Elemente, die sich bei Poe finden?
Ein Mord hat sich ereignet, zudem in einem verschlossenen Raum (somit ist dies auch der erste Fall eines sogenannten „locked room mystery“). Der Mord geschah, bevor die eigentliche Handlung einsetzt – der Detektiv Dupin erfährt aus zweiter Hand (in diesem Beispiel aus der Zeitung) von dem Verbrechen. Alle wichtigen „clues“ (Hinweise) werden dem Leser präsentiert, wodurch das „fair play“ zwischen Detektiv und Leser gegeben ist. Weiterhin wird der Leser durch „red herrings“ (falsche Fährten) in die Irre geführt, dadurch wird das Lösen des Rätsels zu einer intellektuellen Herausforderung (Denksportaufgabe). Der Täter wird mit Hilfe einer Falle, die der Detektiv stellt, überführt. Die Lösung des Falls wird dem Leser erst am Ende der Geschichte präsentiert. Und sollte der Leser den falschen Fährten gefolgt sein, ist die Lösung eine Überraschung für ihn. Weiteres wichtiges Element der Erzählung ist der Assistent oder Helfer, den Dupin hat, und dem er seine Schlußfolgerungen berichten kann.
Zusammengefaßt sind die wichtigsten Elemente der Detektivgeschichte:
Daran läßt sich auch der zeitliche Verlauf einer Detektivgeschichte erkennen, wie sie auch Alewyn aufzeigt: Das Verbrechen ist bereits geschehen (Vergangenheit), Einzelheiten der Tat werden im Laufe der Erzählung Stück für Stück berichtet, die clues werden durch den Detektiv zusammengeführt, es folgt ein Höhepunkt, bei dem der Täter in eine Falle gelockt wird und der Detektiv, dank seiner intellektuellen Überlegenheit, den Täter entlarven kann. Somit gibt es einen linearen Spannungsverlauf:
Entdeckung der Tat → Ermittlung → Rekonstruktion der Tat → Zusammenführung der clues → Falle → Überführung des Täters
Weiterhin gibt es bestimmte Figuren, die ein Detektivroman enthält: Einen Täter, eine möglichst geschlossene Gruppe von möglichen Tatverdächtigen und Zeugen, einen Detektiv sowie seinen Helfer. Wenn man sich heutige Krimis anschaut, so fallen natürlich sofort Unterschiede auf: Es gibt manchmal mehrere Täter, oft bleibt es nicht bei einem Mord und der Detektiv kann durchaus auch ein Polizist, Kriminalbeamter, Psychologe oder Gerichtsmediziner sein und er muss nicht unbedingt einen Helfer haben – und wenn er einen oder mehrere Helfer hat, so können diese im Team zusammen einen Fall lösen. Regelrecht entgegen konstruiert sind zum Beispiel Krimis, in denen der Täter gleich zu Anfang bekannt ist, wo der Leser den Täter bei seinen Taten begleitet und wo er mit dem Täter gegen dessen Aufdeckung „mitfürchtet“. Ein schönes und gelungenes Beispiel sind etwa die Ripley-Romane von Patrica Highsmith (1921-1995). Auch das „fair play“ ist nicht immer gegeben, die Figur des Täters oder auch des Ermittlers wird psychologisch ausgemalt etc.
Eine Ausweitung einer Detektivgeschichte zu einem Detektivroman zeigt sich etwa bei Wilkie Collins (1824-1889) in seinen Romanen „The Moonstone“ (1868, dt. „Der Monddiamant“) und „The Woman in White“ (1860, dt. „Die Frau in Weiß“). So gibt es zwar in „The Moonstone“ einen kriminellen Fall (der Diebstahl des Monddiamanten) und auch ein Detektiv tritt auf (Sergeant Cuff), allerdings ist der Anteil der eigentlichen Kriminalgeschichte eher gering, um den Krimiplot herum wird eine Liebesgeschichte erzählt. Bei Collins „Monddiamant“ handelt es sich eher um eine geheimnisvolle Liebesgeschichte. Zum ersten Mal in der Geschichte des Detektivromans finden sich bei Collins subjektive Berichte des Geschehen: In beiden erwähnten Romanen lässt Collins die Geschichte durch Berichte der beteiligten Figuren schildern. Durch das Fehlen eines allwissenden Erzählers schafft Collins Nähe aber auch Verwirrung beim Leser. Welcher Schilderung kann man glauben?
Weiterentwickelt wurde die Detektivgeschichte durch Arthur Conan Doyle (1859-1930) mit seinen bekannten „Sherlock Holmes“-Geschichten und -Romanen (etwa „A Study in Scarlet“, 1887, dt. „Eine Studie in Scharlachrot“; „The Sign of the Four“, 1890, dt. „Das Zeichen der Vier“; „The Hound of the Baskervilles“, 1901/1902, dt. „Der Hund der Baskervilles“, sowie diverse Erzählungen, die ursprünglich im „Strand Magazin“ erschienen sind und anschließend in Anthologien zusammengefaßt wurden, wie etwa „The Adventures of Sherlock Holmes“, 1892, dt. „Die Abenteuer des Sherlock Holmes“ etc.)
Arthur Conan Doyle, eigentlich Arzt, vertrieb sich die Zeit mit Schreiben von Detektivgeschichten – und erlangte damit Weltruhm. Ihm selber wurde sein Held Sherlock Holmes immer mehr zur Last, so dass er ihn in „The Final Problem“ (1894, dt. „Das letzte Problem“) in die Reichenbachfälle stürzen ließ – doch die Empörung der Leser war so groß, dass Doyle seinen Held wiederbeleben mußte und zwar in „The Empty House“ (1894, dt. „Das leere Haus“).
Während Poes Dupin recht spröde seine Fälle vom Sessel aus analysiert und den Täter überführt, ist Doyles Sherlock Holmes eine unterhaltsame Figur, nicht zuletzt durch seinen Gehilfen Dr. Watson, mit dem er zusammen die Fälle löst. Und Holmes ist auch kein „Armchair Detective“ mehr – er agiert, er bewegt sich, belauscht und ergreift den Täter. Aber auch er schlußfolgert aus den gegebenen „clues“ und setzt seine Logik ein. Holmes strahlt die Stärke und Sicherheit eines Experten aus, der genau weiß, wie er an einen Fall heranzugehen hat. Zudem ist er ein aristokratischer Held, der sich die Frage nach dem „Warum?“ eigentlich nie stellt – Fragen der Moral oder die Hintergründe einer Tat interessieren in nicht.
Quasi als Antwort auf den „Helden“ Holmes erschuf Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) seinen Pater Brown („The Innocence of Father Brown“, 1911, dt. „Father Browns Einfalt“; „The Wisdom of Father Brown“, 1914, dt. „Father Browns Weisheit“; „The Incredulity of Father Brown, 1926, dt. „Father Browns Ungläubigkeit“; „The Secret of Father Brown“, 1927, dt. „Father Browns Geheimnis“ sowie „The Scandal of Father Brown“, 1935, dt. „Father Browns Skandale“). Pater Brown ist ein unscheinbarer Geistlicher, der die Kriminalfälle aus der Sicht des Geistlichen und Seelsorgers löst. Zwar ermittelt er auch den Täter, aber für ihn sind die Täter Sünder, das Seelenheil seiner Schäfchen ist im wichtiger. Oft entgehen sie der weltlichen Gerechtigkeit – Pater Brown vertraut auf die Bestrafung durch Gott.
Weitere Gegenentwürfe zum Helden Sherlock Holmes finden sich etwa bei Edmund C. Bentley (1875-1956) in „Trent’s Last Case“ (1912), in dem er seinen Detektiv, der mit der gleichen Vorgehensweise wie Holmes arbeitet, scheitern läßt. Und auch Maurice Leblancs (1864-1941) Held Arsène Lupin ist eine Karikatur von Holmes (etwa in „Arsène Lupin contre Sherlock Holmes, 1908)
Nachdem Ersten Weltkrieg befindet sich der Detektivroman im Umbruch, die oben erwähnten Regeln werden aufgestellt und Schriftsteller gründen 1929 in London den „Detection Club“. 1920 erscheint der Roman „The Mysterious Affair at Styles“ (dt. „Das fehlende Glied in der Kette“) von Agatha Chistie (1890-1976) und damit wird das „Goldene Zeitalter“ des Krimis eingeläutet. Christies Krimis (über 100 Titel) weisen in der Regel die gleiche Struktur auf. Es geschieht ein Verbrechen, meistens ein Mord, es folgt die Fahndung nach dem Verbrecher (den Verbrechern), die Rekonstruktion des Tathergangs, die Suche und Aufklärung des (Mord-)motives, die Lösung des Falls und Überführung des Täters. Christies Romane sind somit „Rätselkrimis“ und „Cozies“, in denen die durch das Verbrechen verursachte Unordnung durch den Detektiv wieder in Ordnung gebracht wird. Ihre Detektive wie etwa Hercule Poirot oder Miss Marple verfügen über analytisches Denken, tragen die „clues“ gewissenhaft zusammen, kommen aber auch manchmal an Grenzen. Dabei sind sie als skurrile Gestalten angelegt, die das Interesse des Lesers wecken. Weitere Roman von Agatha Christe sind etwa „The Murder of Roger Ackroyd“ (1926, dt. „Alibi“), „The Murder in the Vicarage“ (1930, dt. „Mord im Pfarrhaus“), „Murder on the Orient Express“ (1934, dt. „Der rote Kimono“ bzw. „Mord im Orient Express“) und „The ABC Murders“ (1936, dt. „Die Morde des Herrn ABC“). Während die englischen Originalausgaben bereits in den 20er und 30er Jahren erschienen, kam die erste deutsche Übersetzung „Rächende Geister“ erst 1947 heraus und die eigentliche Rezeption von Agatha Christie in Deutschland erfolgte in den 50er Jahren(!).
Eine weitere wichtige Autorin des „Goldenen Zeitalters“ ist Dorothy L. Sayers (1893-1957), die mit ihrem Lord Peter Wimsey eine Paradefigur des Dandys als Detektivs geschaffen hat. Wimsey gehört der obersten Schicht an und da er dort keine Funktion erfüllen muss, widmet er sich aus reinem Vergnügen der Verbrecherjagd. Wichtige Romane sind „Clouds of Witness“ (1926, dt. „Diskrete Zeugen“), „The Unpleasentness at the Bellona Club“ (1928, dt. „Ärger im Bellona-Club“), „Whose Body?“ (1930, dt. „Ein Toter zuwenig“) „Have His Carcase“ (1932, dt. „Zur fraglichen Stunde“) „Murder must Advertise“ (1933, dt. „Mord braucht Reklame“) und „Gaudy Night“ (1935, dt. „Aufruhr in Oxford“). „Gaudy Night“ ist ein besonderer Detektivroman – zählt er doch zu den sogenannten „Oxfordkrimis“ und einige Kritiker sehen in ihm gar keinen richtigen Krimi. So gibt es keinen Mord, das Verbrechen besteht hier in Drohbriefen und Verleumdungen, welche die Studentinnen und Dozentinnen eines Oxforder Colleges bekommen bzw. ausgesetzt sind. Harriet Vane, eine Freundin von Wimsey und ehemalige Studentin in Oxford, ermittelt im College ohne Erfolg, so dass Lord Wimsey zur Hilfe gerufen wird und Harriet Vane vor einem Mordanschlag retten kann. Entscheidend bei „Gaudy Night“ ist, dass die beiden Detektive nicht mehr von außen die Täterermittlung durchführen, sie sind derart in die Handlung verstrickt und persönlich davon betroffen, dass sie die Überführung des Täters als beteiligte Figuren erleben und diese auch für sie lebensnotwendig ist. „Gaudy Night“ zählt weiterhin zu den Krimis mit gehobenen literarischen Ansprüchen, viele Elemente im Krimi sind romanhaft, die Darstellung des Lebens im College nimmt sehr viel Raum ein.
Ein weiterer Vertreter des „Goldenen Zeitalters“ ist John Dickson Carr (1906-1977), der mit seinem Roman „The Hollow Man“ (1935, dt. „Der verschlossene Raum“) ein Paradebeispiel für ein „locked-room-mystery“ liefert. Es gibt eine Reihe von Autoren die noch zu nennen wären, wie etwa Ellery Queen (wohinter sich die Autoren Frederic Dannay (1905-1982) und Manfred B. Lee (1905-1971) verbergen), Josephine Tey (1897-1951), S.S. van Dine (Pseudonym für Williard Huntington Wright, 1888-1939), Margery Allingham (1904-1966) oder Rex Stout (1886-1975), der mit seinem Nero Wolfe einen klassischen „Armchair Detective“ erschuf.
Das Ende des „Goldenen Zeitalters“ wird oft mit dem Jahr 1939, also dem Beginn des zweiten Weltkriegs, datiert. Trotzdem wurde die Tradition des Detektivromans auch bis in unsere Zeit fortgeführt, zum Teil mit Varianten, aber der Kern (Mord, Mordermittlung, Aufklärung, Täterüberführung) blieb bestehen. Zu den wichtigen Autorinnen, die der Tradition des Detektivromans verpflichtet sind, gehören unter anderem Margaret Millar, P.D. James oder aber Martha Grimes .
Eine weitere Variante des Detektivromans liefert Georges Simenon (1903-1989) mit seinen „Maigret“-Romanen. Maigret ist kein überheblicher Detektiv, er ist tief verbunden mit dem kleinbürgerlichen Milieu, in dem er ermittelt. Die Opfer erscheinen bei Simenon oft als schlechte Charaktere, so dass der Leser mit dem Täter sympathisieren kann. Maigret ist kein Superheld wie etwa Sherlock Holmes, er ist sehr menschlich, hat Launen und kann sehr kurz angebunden sein. Ihn interessiert bei seiner Ermittlungsarbeit nicht so sehr das „Wer war es?“ (Whodunit?) – sondern das „Warum?“, das Motiv der Tat und die psychologischen Hintergründe. Ähnliche Strukturen lassen auch die Krimis von Friedrich Glauser (1896-1938) erkennen, der mit Wachmeister Studer ebenfalls einen kleinbürgerlichen Detektiv erfunden hat.
Und die Entwicklung des Detektivromans ging weiter: So kann man heute etwa zwischen Frauenkrimis, Kinderkrimis, Gerichtskrimis, Katzenkrimis, historischen Krimis oder Krimis unterscheiden, die in einem bestimmten Milieu spielen, wie etwa in Bibliotheken oder Universitäten, im Milieu des Pferdesports oder in schwulen Kreisen. Ob dies alles sinnvoll ist, sei einmal dahin gestellt.
Doch neben all diesen Varianten, die mehr oder weniger dem Detektivroman nahe stehen, entwickelten sich auch eigene Unterarten des Kriminalromans, die mit dem Detektivroman nicht mehr viel gemeinsam haben. So etwa der Thriller, die Hard-boiled-Krimis oder etwa die Spionage- und Agententhriller.
Nun, was soll der – sehr verkürzte – Ausflug in die Geschichte? Zeigt er doch, dass am Anfang der Mord war, der aufgeklärt werden musste, eine Ordnung, die kurzzeitig ins Chaos stürzte, wurde am Ende wieder hergestellt, es war alles wieder heile. So simpel sind heute Kriminalromane glücklicherweise nicht mehr.
Was aber erwarte ich als Leser von einem Kriminalroman?
Spannung, überraschende Wendungen, glaubhafte Figuren, glaubhafter Plot, passende, gelungene Sprache, Verwirrung, surreales Erzählen, Reflexionen zur Zeit, Gesellschaftskritik, Statement, Denkanreiz, fremde Welten, die glaubhaft dargestellt werden, Sex, Erotik, Exotik, Liebesgeschichte, Unterhaltung….??? Wie stellt dpr im Hinternet-Weblog fest:
Well, that’s fucking Hochliteratur indeed, wie man es in früheren, besseren Zeiten nennen durfte, als nicht anämische Ich-Forscher, Befindlichkeitshanseln und Icke-hab-ne-Botschaft-Posaunisten die stolze Galeere enterten, auf der sich die Meister keuchend in die Riemen legten. Heutzutage segelt das Schiffchen harmlos über die Meere des Flachsinns, die Ozeane der geistigen Untiefe, vom schwindsüchtigen Atem der Literaturkritik in die Segel gepustet. Doch lassen wir das.
Nee, genau das sollten wir nicht lassen, enthält dieser Auszug, wenn auch ex negativo, einen guten Ansatz, wie Kriminalliteratur nicht sein sollte. Sach ich jetzt mal so….
Entwickelt sich der Krimi weiter?
Hoffentlich tut er das. Der Blick über den deutschen Tellerrand hinaus zeigt, dass es durchaus spannende Entwicklungen gibt – siehe etwa Lateinamerika, siehe Asien, siehe Afrika. Selbst im trüben, deutschen Krimieinerlei, zwischen Plagiaten, Abgekupfertem, Ausgelutschtem, regionalem-Hund-Katze-Klosett-Krimi, finden sich Perlen. Wir werden sehen, wie es weiter geht. Wenn zur Entwicklung das Spiel mit dem Genre und seinen Regeln nötig ist (es ist nötig), dann bitte: Ich lasse mich überraschen. But that’s not my business – ich schreibe keine Krimis, ich lese sie nur. Warum zerbreche ich mir eigentlich mein zartes Köpfchen mit Dingen, über die sich ganz andere Damen und Herren mal verstärkt Gedanken machen sollten? Dennoch, eine Regel gilt für Krimiautor/innen auf jeden Fall, ob traditionell, modern, postmodern oder wie auch immer:
Und jetzt geh‘ ich Krimi lesen – hab‘ ich mir verdient….
P.S.: Gaaaaanz wichtiger Link: A Guide to Classic Mystery and Detection. Immer einen Klick wert.
Als renitenter Schüler der Crime School hat Lehrer dpr mich nun doch erwischt. Mist! Klassenarbeit – wie furchtbar. Die Aufgabe:
Was gehört zum Genre „Krimi“?
Was muss UNBEDINGT in einem Krimi vorhanden sein – und was darf keinesfalls?
Kann man das Genre erweitern? Muss man es gar? Und wie? Und wie bitte nicht?
Na, dann muss ich mich wohl mal hinsetzen und meine kleinen grauen Zellen anstrengen. Wait and see.
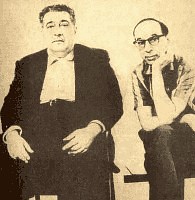 Leonardo Padura: Labyrinth der Masken
Leonardo Padura: Labyrinth der Masken
»Todsünde, gesellschaftlich schädliche Abnormität, psychische und physische Krankheit, nirgendwo auf der Welt ist es leicht, schwul zu sein, mein Freund, Herr Polizist, das kann ich Ihnen sagen. «
Reinaldo Arenas, Severo Sarduy, José Lezama Lima und Virgilio Piñera dürften bei uns in Deutschland nur wenigen Lesern und Leserinnen bekannt sein. Gemeinsam ist diesen vier Autoren, dass sie Kubaner und homosexuell waren. Das Foto links zeigt übrigens José Lezama Lima zusammen mit Virgilio Piñera im Jahre 1974. José Lezama Lima, der „Dicke“, wie er auch spöttisch genannt wurde, dürfte wohl der bekannteste von den vier Autoren sein. Sein monumentaler Roman „Paradiso“, ein barockes, wucherndes Sprachkunstwerk, wurde immerhin im Zuge des „Booms“ lateinamerikanischer Literatur in den 1970er und 1980er Jahren ins Deutsche übersetzt. Sein unvollendetes Werk „Oppiano Licario“ wurde erst im letzten Jahr den deutschsprachigen Lesern und Leserinnen in einer Übersetzung zugänglich gemacht.
Mit Reinaldo Arenas und Severo Sarduy dürfte es da schon schlechter aussehen: Areanas hat vor allem in der schwulen Szene mit seiner wütenden Autobiographie „Bevor es Nacht wird“ für Furore gesorgt. 2000 wurde diese Biographie auch unter dem englischen Titel „Before Night Falls“ verfilmt. Ein Film, in dem unter anderem Sean Penn und Johnny Depp kurze Gastauftritte hatten und der bei Kritikern ein geteiltes Echo auslöste. Severo Sarduy wurde ebenfalls eher in der schwulen Szene bekannt, als seine beiden Romane „Kolibri“ und „Woher die Sänger sind“ in der kleinen Edition diá erschienen. Bereits 1968 wurde der Band „Bewegungen“ mit Erzählungen Sarduys und ein Jahr später „Flamenco“, eine Sammlung von Gedichten, veröffentlicht.
Literarisches Denkmal
Richtig düster ist es jedoch um den Autor Virgilio Piñera, laut Kennern der kubanischen Literatur einer der wichtigsten Dramatiker des Landes im 20. Jahrhundert, bestellt. Gerade mal sein Roman „Kleine Manöver“ liegt in einer (vergriffenen) Übersetzung vor. Nun mag sich mancher fragen: Ja, und? Es gibt viele, vergessene Autoren und Autorinnen – erst recht aus Lateinamerika. Immerhin: Virgilio Piñera erhält durch den neusten Kriminalroman von Leonardo Padura ein Stück der Reputation zurück, die er vermutlich verdient hätte. Padura setzt seinem schwulen Landsmann in „Labyrinth der Masken“ (span.: „Máscaras“) ein literarisches Denkmal und spürt haargenau den Repressionen nach, denen homosexuelle Männer in Castros Kuba ausgesetzt waren und sind.
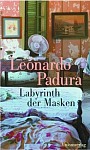
Padura erzählt die Geschichte vom Mord an dem jungen Alexis Arayán, Sohn eines hohen Diplomaten, der am 6. August, am Tag der Verklärung Jesu, im Stadtwald von Havanna erwürgt aufgefunden wird. Arayán ist als Frau, genauer gesagt als Electra verkleidet, eine Figur aus dem Stück „Electra Garrigó“ von eben diesem Virgilio Piñera. In Arayáns After finden die Ermittler zwei Geldstücke, die sie vor ein Rätsel stellen: Warum ermordet jemand einen schwulen Transvestiten und „bezahlt“ ihn dann auf diese groteske Weise?
Dem Rätsel nachspüren muss der mürrisch-melancholische Mario Conde, Lesern und Leserinnen bereits aus den ersten beiden Bänden von Paduras „Havanna-Quartett“ – „Ein perfektes Leben“ und „Handel der Gefühle“ – gut bekannt. Nach einer Schlägerei ist Teniente Conde eigentlich strafversetzt, doch sein Chef, Mayor Antonio Rangel, hat zu wenig Personal, also soll Conde, zusammen mit seinem Kumpel Sargento Palacios, den Fall möglichst schnell lösen. Keine leichte Aufgabe für den bekennenden Schwulen- und Tuntenhasser Conde. Weibische Männer sind ihm zuwider, doch dummerweise spielen gleich zwei schwule Männer eine wichtige Rolle bei der Ermittlung. Da ist zunächst der Maler Salvador K., ein verheirateter Mann, der vermutlich eine Liebesbeziehung zu Alexis Arayán unterhielt und nach einem ersten Verhör durch Conde wie vom Erdboden verschwunden scheint.
Poetisches Portrait und politische Positionierung
Die zweite, zentralere Figur ist jedoch der Dramaturg Alberto Marqués, das Alter Ego Virgilio Piñeras im Roman. Bei ihm hat der Ermordete zuletzt gewohnt und in ihm findet Mario Conde, der Möchtegern-Dichter, einen Lehrer. Zwar ist Conde der alternde Dichter zunächst ein Gräuel, aber im Laufe der Ermittlungen weckt Marqués in Conde erneut die Leidenschaft fürs Schreiben und die Abneigung des Machos weicht der Erkenntnis, einen wunderbaren, respektablen und eigensinnigen Menschen getroffen zu haben.
In Rückblenden – ein Kunstgriff, den Padura meisterlich beherrscht – erzählt Marqués von seinen bewegten Zeiten, als sein Stern als Dramaturg immer höher stieg, er in Paris mit Jean Paul Satre und Simone de Beauvoir verkehrte und das anrüchige Nachtleben an der Seine genoss. Leider einmal zu viel, denn als ein schwuler Freund von Marqués bei einer nächtlichen Orgie von der Polizei aufgegriffen wird, bekommt die kubanische Botschaft davon Wind. Kaum nach Havanna zurückgekehrt, erfährt auch Marqués, wie die kubanischen Sozialisten mit „dekadenten, bürgerlichen“ Feinden der Arbeiterklasse umgeht: Seine Theatergruppe schließt Marqués aus und er muss schließlich Frondienst in einer Bibliothek leisten. Dennoch brechen die Repressionen nicht seinen Willen, Marqués schweigt und schreibt heimlich, wie er später Conde beichtet, weiter.
Der Kriminalroman als aufklärerisches Instrument – bei Leonardo Padura funktioniert dies wunderbar. Nicht nur sein sehr poetisches Portrait des alternden Dichters Alberto Marqués respektive Virgilio Piñera verleihen diesem Kriminalroman Tiefe und Bedeutung. Es ist auch Paduras klarer und scharfer Blick auf die Unterdrückung von „andersartigen“ Menschen, von Außenseitern in der sozialistischen Gesellschaft Kubas. Ein Kapitel, das gerne in der geschichtlichen Betrachtung vergessen wird, bei Padura bekommt es jedoch Gewicht, Aufmerksamkeit und eine wohltemperierte, durchdringende Stimme. Gerade die Homophobie eines Mario Condo lassen den Roman so real, so echt erscheinen, und seine Wandlung, sein Blick hinter die Fassaden der Transvestiten auf die Menschen machen diesen Roman zu einem bewegenden Stück Kriminalliteratur. In den geschminkten Gesichtern der Ausgestoßenen und Verwunschenen spiegelt sich auf erschreckende, schmerzhafte Weise die Absurdität des kubanischen Machismo und die Menschenverachtung des sozialistischen Systems. Paduras Verdienst kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Leonardo Padura: Labyrinth der Masken : Das Havanna-Quartett »Sommer« / Aus dem kubanischen Spanisch von Hans-Joachim Hartstein. Mit einem Nachwort von Thomas Wörtche.
Zürich : Unionsverlag, 2005
ISBN 3-293-00323-0
(metro – Spannungsliteratur im Unionsverlag)Buch bestellen bei:
» amazon.de » libri.de » buch24.de
»König«, sagte er zu mir (manchmal beförderte er mich vom Marqués zum König), »der menschliche Transvestit ist ein Fantasiegebilde, die Zusammenfassung der drei Möglichkeiten der Mimikry.« Er machte eine Pause, um von dem herben griechischen Wein zu trinken, der in hübschen Imitationen antiker Amphoren serviert wurde. »Erstens: der Transvestismus im eigentlichen Sinne des Wortes, der dem unbegrenzten Drang zur Metamorphose innewohnt, jener Umwandlung, die sich nicht auf die bloße Imitation eines bestimmten, realen Modells beschränkt, sondern es auf eine unendliche (und als solche vom Beginn des >Spiels< an akzeptierte) Realität abgesehen hat. Es handelt sich um eine immer flüchtigere und unerreichbarere Irrealität: immer mehr Frau sein, ja, über die Grenze hinaus, über die Frau hinaus... Zweitens: die Camouflage. Denn es deutet alles darauf hin, dass die kosmetische (oder sogar chirurgische) Umwandlung des Mannes in eine Frau eine Art Verschwinden zum heimlichen Ziel hat, ein Unsichtbarmachen, ein effacement, ein Auslöschen des betreffenden Mannes in dem aggressiven Verband der Männer, in der brutalen Männerhorde. Und drittens ist da noch das Moment der Einschüchterung, denn die häufig zu beobachtende Übertreibung, die Maßlosigkeit des Make-ups, die offensichtliche Künstlichkeit, die schillernde Maske, all das soll erschrecken und lähmen, wie bei bestimmten Tieren, die ihre äußere Erscheinung dazu benutzen, zu jagen oder sich zu verteidigen, natürliche Mängel zu verbergen oder nicht vorhandene Eigenschaften wie zum Beispiel Mut oder Geschicklichkeit vorzutäuschen, nicht wahr?«
Leonardo Padura: Labyrinth der MaskenTreffender habe ich Transvestismus selten beschrieben gesehen. Mehr dazu morgen.
Da bin ich gestern in vier Buchhandlungen und einem Antiquariat gewesen und von Raabes „Stopfkuchen“ keine Spur. In einer Buchhandlung löste meine Nachfrage Verwunderung aus: „Raabe, der wird kaum noch gedruckt, der hat doch was Antisemitisches geschrieben“. Scheint wohl tatsächlich so zu sein, sein „Hungerpastor“ soll solche Tendenzen aufweisen, schreibt auch Rolf Vollmann:
Raabe schreibt den Hungerpastor, ewige Jahrzehnte lang sein gelesenstes Buch und das, woran sein Ruhm gemessen wurde: ein schlechter, falscher Ruhm, und das nicht allein der sehr starken antisemitischen Tendenzen wegen, die man, wenn man wollte, dem Werk entnehmen konnte – wenn man wollte: Raabe war zweifellos kein Antisemit, aber seine falschen Leser wollten mit Figuren bedient werden, die, wie in Freytags Soll und Haben, Juden als verachtens- und hassenswerte Charatkere zeigten; und Raabe, leider, war jahrzehntelang ganz einverstanden mit dieser schlimmen Einvernahme. Aber der Schaden war unermeßlich; ein Autor, der den großen Ruhm mit der Chronik der Sperlingsgasse und dem Hungerpastor geerntet hatte, fand, als die Verehrer dieser Bücher ausgestorben waren, jahrzehntelang gar keine Leser mehr, keine Leser also auch für die wunderbaren späten Bücher, von denen Raabe selber genau wußte, daß sie die weit besseren waren.
Rolf Vollmann: Die wunderbaren Falschmünzer
Nun denn, der Stopfkuchen muss also bis nach Ostern warten, weil das Buch erst noch bestellt werden muss.
Unterdessen geht es in der Crime School schon in die vierte Lektion, diesemal zum Thema Nabokov und sein Buch Lolita. Geht ja wirklich zügig voran, Lolita müsste auch noch hier im Regal stehen, wenn ich es denn finden würde…. Aber so schnell bin ich mit dem Lesen nun auch nicht.
In der dritten Lektion der Crime School des Hinternets macht uns Lehrer dpr auf einen alten Meister aufmerksam, den ich, bekenne ich freimütig, auch nicht auf der Liste hatte: Wilhelm Raabe. An dessen Erzählung „Stopfkuchen“, die Raabe selbst für sein bestes Buch hielt, erklärt uns dpr, wie Meister Raabe konträr zu den Regeln des Kriminalromans , obwohl es die noch gar nicht gab, eine Kriminalgeschichte erzählt. Nun, was habe ich also über die Ostertage zu tun? Genau, ich werde nachher in die Buchhandlung rennen und hoffen, das „Stopfkuchen“ als Büchlein vorliegt. So schön es ist, dass der Text beim Projekt Gutenberg online zu lesen ist, meine armen Augen werden über die Papierform dankbar sein.
 Zwischen St. Pauli, Stockholm und Swinoujscie
Zwischen St. Pauli, Stockholm und Swinoujscie
Uwe Friesel: Blut für Eisen
Guido Blankenhorn ist wieder da. Schon in den 1980er Jahren schickte ihn sein Erfinder, der Autor Uwe Friesel, auf Verbrecherjagd. Nach einer längeren Pause kehrt der kautzige Privatermittler und ehemalige Polizist zurück. In seinem neusten Fall „Blut für Eisen“ soll Blankenhorn im Auftrag der Autoversicherer den organisierten Diebstahl von Luxuskarossen aufklären. Nicht das einzige Delikt, das Blankenhorn während seiner Ermittlungen Kopfzerbrechen beschert. Gleich zu Anfang fliegt im Hamburger Elbtunnel eine Luxuslimousine in die Luft, dann wird eine weibliche Wasserleiche gefunden, ein Polizeispitzel wird grausam ermordet und Blankenhorns Lieblingsitaliener geht in Flammen auf.
So viele Verbrechen kann einer alleine natürlich nicht bewältigen, also stellt Autor Friesel dem Privatermittler eine Reihe von Helfern an die Seite. Da ist Blankenhorns Nachfolger bei der Polizei, der muffelige Kriminalrat Merseberg, der die Aufklärung des organisierten Verbrechens in Hamburg koordinieren soll. Weiterhin mit von der Partie ist Gerda Tosbiel, Journalistin und Bekannte von Blankenhorn. Sie begibt sich zwecks Recherche ins benachbarte Polen, genauer gesagt nach Swinoujscie (Swinemünde). Der Verdacht: Mädchenhändler schmuggeln Frauen aus Osteuropa, vor allem aus Weißrussland, Russland und Polen über die Grenze bei Swinoujscie nach Deutschland, um sie dort als Prostituierte arbeiten zu lassen.
Ja, ist denn schon 2005?
Die osteuropäische Mafia ist eine unheilvolle Allianz mit der ‘Ndrangheta, der kalabresischen Mafia, eingegangen. Geschäftsfelder der unsympathischen Herren: Autoschmuggel, Menschenhandel, Prostitution, Schutzgelderpressung. Alles nicht nett, aber alles sehr bekannt. Würde Autor Friesel nicht hin und wieder recht junge Zeitmarken, wie etwa den 11. September 2001 oder eben die offene Grenze zu Polen setzten, man könnte annehmen, man lese einen Krimi aus den 1970er Jahren. So alt- und hausbacken strickt Friesel seine Story. Keine Überraschung, keine Spannung, nur selten ein Hauch von Humor.
Hinzu kommt eine recht verwirrende Anzahl an ermittelnden Figuren und zerfaserten Seitensträngen. Friesel wechselt die Schauplätze – St. Pauli, Stockholm, Swinoujscie und das Alte Land bei Hamburg – in einem raschen Tempo, versäumt aber, eine wirkliche Haupthandlung heraus zu arbeiten. Auch löst er nicht wirklich alle Stränge am Ende auf, was dem Buch keinen wirklich guten Abschluss gibt. Kurz: Auch dieser Band in der neuen Reihe „Die Dunklen Seiten bei nymphenburger“ ist eine krasse Enttäuschung. Guido Blankenhorn wäre besser in der Versenkung geblieben.

Uwe Friesel: Blut für Eisen : Ein Blankenhorn-Roman
München : Nymphenburger, 2005
ISBN 3-485-01040-5
(Die Dunklen Seiten bei nymphenburger)
Buch bestellen bei:
» amazon.de » libri.de » buch24.de
Was ist eigentlich “realitätstüchtig“? Über den Realismusbegriff sind in den 80er und 90er Jahren Doktorarbeiten geschrieben worden, die schon damals ziemlich lächerlich waren. Realität ist das, was in einem Text steht. Punkt. Wenn zwei Engel am Horizont fliegen und die Weißwürste nach Bier schmecken und Muckis machen, dann ist das halt die WIrklichkeit des Romans. Meinetwegen auch des Krimis.
schreibt dpr in seinem Kommentar zu meinen Eintrag zur Crime-School.
Nun, die Diskussion um Realismus im Krimi ist in der Tat schon alt. Der Begriff „realitätstüchtig“ fiel mir in einigen Rezensionen von Thomas Wörtche auf. Ich interpretiere diesen Begriff in Bezug auf Kriminalliteratur vor allem als eine Aussage in Bezug auf Plausibilität und Glaubhaftigkeit. Kriminialliteratur wird – spätestens seit dem Aufkommen des sogenannten Soziokrimis – immer wieder (auch) als Gesellschaftsroman gesehen. Einige Interpreten gehen sogar soweit zu sagen, dass er die einzige, moderne Form des Gesellschaftsromans sei und/oder behaupten, der Kriminalroman könne die menschlichen Realitäten glaubwürdig kritisieren. Sjöwall/Wahlöö etwa nutzten die Form des Kriminalromans, um Kritik am schwedischen Polizeisystem und letztlich an der Politik ihres Landes zu üben. Das hier die – bis dahin oft recht simple Form der Spannungsliteratur – manchmal überfordert war, scheint mir nicht von der Hand zu weisen. Andererseits gab dies dem Kriminalroman neue Impulse und Richtungen – der Kriminalroman und seine Ästhetik wuchs an der Aufgabenstellung, gesellschaftspoltische Positionen zu beziehen.
Der verklemmte Krimileser
Heute wird darüber gerne die Nase gerümpft, weil Kriminalliteratur ja vor allem als Unterhaltungsliteratur gesehen wird. Ich denke, diese Trennung zwischen reiner Unterhaltung und sogenannter „hoher“ Literatur hat sich überlebt – auch wenn es natürlich nach wie vor für beides Bespiele gibt. Es spricht ja nichts dagegen, wenn mich ein Krimi gleichzeitig unterhält und aufklärt, spannend und schlau zugleich ist. Realismus oder „realitätstüchtig“ ist in diesem Zusammenhang vor allem eine Frage der Logik, der Nachvollziebarkeit, der Glaubhaftigkeit. Das tatsächliche Morde im Polizeialltag eher tragisch, traurig und trist, meistens aber nicht spannend sind, wird wohl kaum jemand bestreiten. Eigentlich kein Stoff also für eine Spannungsgeschichte. Also hat Kriminalliteratur nichts mit Realität zu tun? Da habe ich meine Zweifel. Um als Geschichte packend zu sein, muss er schon glaubhaft und „echt“ wirken. Wenn zwei Engel durchs Bild fliegen, dann mag das die Realität des Textes sein, mit meiner Leserwirklichkeit hat das nichts zu tun. Bleibt die Frage, was mit oft surrealen, absonderlichen, schrägen Texten, wie zum Beispiel von Heinrich Steinfest, ist. Überzogene oder überspitzte Darstellung von Realität im Text kann sehr wohl auf die Wirklichkeit des Lesers zurückgreifen oder sie ihm erst dadurch verdeutlichen, Sinne und Verstand schärfen.
Bin ich damit ein „verklemmter“ Krimileser, wie es Anne Chaplet in ihrem Artikel „Berichte aus dem prallen Leben“ (Welt) behauptet? Frau Chaplet schreibt:
„Literatur bildet nicht Wirklichkeit ab, sonst wäre sie Kolportage. Sie verdichtet Realität, höchstens. Vor allem kennt sie keinen Herrn – weshalb mir scheint, der Verweis auf die Realitätsnähe eines Krimis ist nichts als der gängige Vorwand für den verklemmten Krimileser. Das Genre selbst hat ihn nicht nötig. „
Kriminalliteratur hat also nichts mit der Wirklichkeit zu tun? Autoren und Autorinnen fristen lebensfern ein Dasein im Elfenbeinturm der hohen Literatur? Woher nehmen sie ihre Figuren, ihre Geschichten, ihre Sprache? Wirklichkeit beeinflußt nicht? Ich kann es nicht glauben.
Mythos statt Wirklichkeit?
Andererseits: Jerry Cotton – als Figur in den Heftchenromanen – hat nicht unbedingt viel mit der Wirklichkeit eines Agenten des FBI zu tun. Dennoch hat es diese Figur zu einem Mythos geschafft – jenseits der Wirklichkeit. Auch ein Hannibal Lecter ist deutlich überzogener und künstlicher, als es wirkliche Serienmörder sind. Auch er ein moderner Mythos – der eben vielleicht deshalb überhaupt zum Mythos werden konnte, weil er nichts oder nur wenig mit der Realität zu tun hat. In der Tat zeigt sich, dass viele großen Figuren der Kriminalliteratur ( zum Beispiel Sherlock Holmes, Miss Marple oder Sam Spade) kaum etwas mit realen Menschen zu tun hatten. Künstlichkeit als Mittel zum Ruhm? Auch da habe ich meine Zweifel, denn viele dieser Figuren sind in ihrem Mythos gefangen und haben nur wenig mit meiner Lese- und Leserwirklichkeit zu tun. Sie sind, kurz gesagt, Pornografie für den geistigen Eskapismus. Das mag mal unterhaltend sein, doch wie bei den beliebten bunten Heftchen nutzt sich der Effekt schnell ab und neue Reize müssen her. Das ist allenfalls Gebrauchsliteratur, die einen Zweck zu erfüllen hat. Anregung jenseits des kurzen Kicks oder Schärfung der Sinne findet so gut wie nicht statt. Die bedürfen des Realitätsbezugs – die Kriminalgeschichte muss auch etwas mit mir, meinem Leben zu tun haben – sonst kann sie nicht in mein Denken eingreifen oder meine Aufmerksamkeit auf ein Thema lenken, dass mir bislang egal oder schlicht unbekannt war.

Schön: Da kommt ich aus dem Urlaub und schon ist die KrimiWelt-Bestenliste da! Eine interessante Liste, die die Damen und Herren Kritiker/innen vorgelegt haben, auf jeden Fall eine gute Diskussionsgrundlage. Es gibt sogar zu den meisten Büchern kurze Begründungen durch einzelne Jury-Mitglieder. Auch das ganze „Drumherum“ ist gut geworden, zumindest auf der ARTE-Homepage. Wird natürlich gleich permanent gelinkt. Immerhin, drei der zehn gelisteten Titel habe ich bereits gelesen, ein vierter Titel ist meine aktuelle Lektüre.
Nur etwas gibt mir dann doch zu denken: In den Links der KrimiWelt steht auch das Nachtbuch (Danke dafür!!!) mit dem abschließenden Kommentar „krimimäßig das heftigste Forum der Republik.“ Bin ich wirklich so heftig? Oder gar böse?